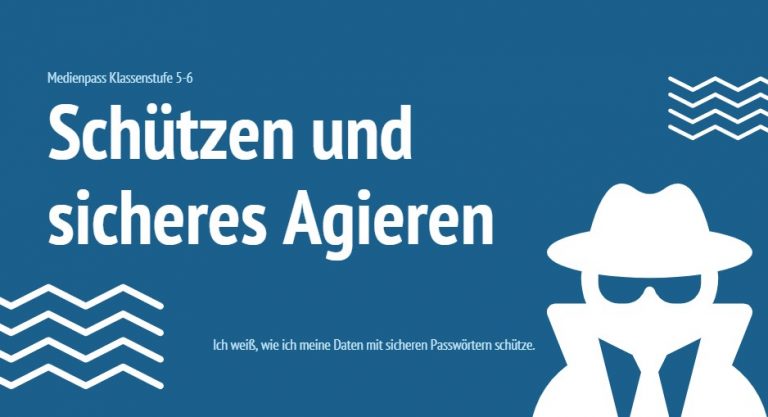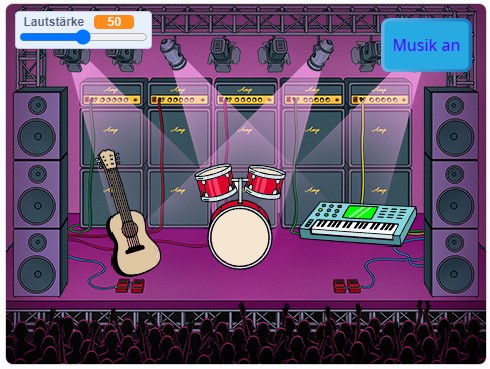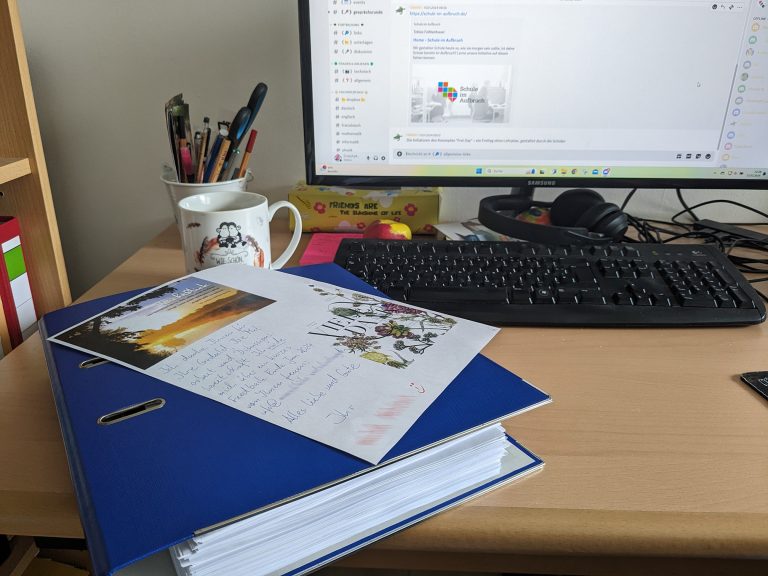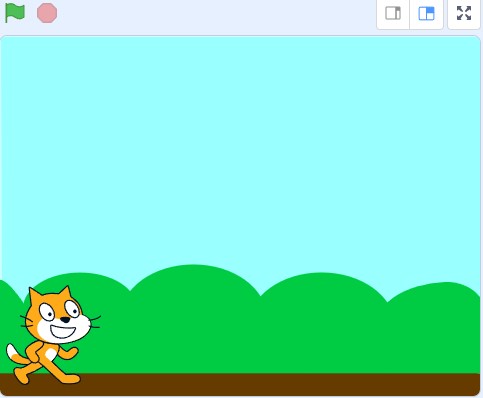Ein Jahr schulpraktische Ausbildung geht zu Ende
Nachdem ich euch in den letzten Blogbeiträgen von der Einstiegsqualifikation und dem Bewerbungsprozess für die schulpraktische Ausbildung (spA) berichtet habe, ist nun auch dieses aufregende Kapitel abgeschlossen. Ein ganzes Jahr lang habe ich, parallel zu meinem Unterricht, diese Ausbildung absolviert. Und ich kann euch sagen, es war eine der anstrengendsten, aber auch bereicherndsten Zeiten meiner bisherigen Laufbahn.
Schulpraktische Ausbildung – was war das nochmal?
Die schulprakitsche Ausbildung – kurz: spA – ist im Grunde ein verkürztes Referendariat von einem Jahr und die berufsbegleitende Qualifizierung für Seiteneinsteiger wie mich. Ich habe die Ausbildung gemeinsam mit Referendarinnen und Referendaren absolviert, die nach ihrem Lehramtsstudium in den Vorbereitungsdienst gestartet sind. Das war eine tolle Gelegenheit, um Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Die Ausbildung fand an der Lehrerausbildungsstätte (in meinem Fall in Dresden) statt und wir hatten immer montags unseren festen Seminartag. Der Seminartag variiert jedoch in den Ausbildungsjahren. Jeder Ausbildungstag war in vier Blöcke von je 1,5 Stunden unterteilt, die sehr intensiv waren.
Inhalte und Schwerpunkte
Die Ausbildung gliederte sich in die drei Hauptbereiche Schulrecht, Bildungswissenschaften und Fachdidaktik.
- Bildungswissenschaften: Diese fanden in einer festen Stammgruppe statt. Wir haben uns mit Themen wie der Unterrichtsplanung, der Gestaltung von lernwirksamen Unterricht, effizientem Klassenmanagement, Leistungsbewertung und Leistungsermittlung sowie dem Umgang mit Heterogenität beschäftigt.
- Fachdidaktik: Hier waren wir in fachspezifischen Gruppen eingeteilt. Die Schwerpunkte waren ähnlich wie in den Bildungswissenschaften, aber immer mit fachspezifischem Blickwinkel. Für Informatik haben wir zum Beispiel verschiedene technische Tools und auch „unplugged“-Varianten für den Unterricht kennengelernt.
- Schulrecht: Der Schulrechtunterricht fand ebenfalls in der Stammgruppe statt. Inhaltlich ging es hier um die rechtlichen Grundlagen unseres Berufs wie Schulpflicht, Aufsichtspflichten, Leistungsermittlung, Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen, Konferenzen, Mitwirkung, Datenschutz und das Lehrdienstrecht.
Unterrichtsbesuche
Während des Ausbildungsjahres gibt es mindestens zwei Unterrichtsbesuche (pro Unterrichtsfach) durch den Fachausbildungsleiter (FAL). Für mich konkret waren das zwei Unterrichtsbesuche, die anstanden. Bei einem solchen Unterrichtsbesuch schaut der FAL ganz genau, wie der Unterricht abläuft und wo es möglicherweise noch Verbesserungspotenzial gibt.
Im Vorfeld zu solch einem Besuch war einiges an Arbeit nötig. Man musste eine sehr detaillierte schriftliche Unterrichtsvorbereitung einreichen. Diese umfasste eine umfangreiche Bedingungsanalyse, in der man die Schüler, die räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten sowie die Lernvoraussetzungen genau beschrieb. Hinzu kam eine exakte Beschreibung der Unterrichtseinheit und eine Begründung für das gewählte didaktische Vorgehen. Ohne Anhänge war diese Vorbereitung ca. 12-15 Seiten lang – also ein ganz schöner Aufwand. Nach der gehaltenen Stunde gab es dann eine Reflexion und ein Auswertungsgespräch mit dem FAL.
Im Gegenzug zu den Unterrichtsbesuchen durch den FAL gab es aber auch eine Gruppenhospitation, bei der die Fachdidaktikgruppe gemeinsam den FAL in seiner Stammschule besuchte, um aus erster Hand zu sehen, wie dieser eine Unterrichtseinheit hält und die gelernten Methoden in der Praxis anwendet. Auch hier gab es eine anschließende Reflexion in der Gruppe gemeinsam mit dem FAL.
Prüfungen
Um die spA abzuschließen, müssen verschiedenen Prüfungen erfolgreich absolviert werden. Hier gibt es Unterschiede je nachdem, wie viele Fächer man als Seiteneinsteiger anerkannt bekommen hat.
- Bei einem anerkannten Fach: Man legt zwei Lehrproben in diesem Fach ab, eine in der Sekundarstufe I und eine in der Sekundarstufe II. Zusätzlich gibt es eine mündliche Prüfung in den Bildungswissenschaften und der Fachdidaktik.
- Bei zwei anerkannten Fächern: Man legt eine Lehrprobe pro Fach ab, ebenfalls eine in der Sekundarstufe I und die andere in der Sekundarstufe II. Es folgen eine mündliche Prüfung je Fach in Bildungswissenschaften und Fachdidaktik sowie eine separate Schulrechtsprüfung.
Lehrproben
Die Lehrproben sind eine echte Herausforderung. Im Vorfeld der Lehrproben ist wieder eine ausführliche schriftliche Unterrichtsvorbereitung anzufertigen. Auch wenn, der Inhaltsteil nur etwa 15 Seiten umfasst, bin ich bei meinen Vorbereitungen mit allen drum und dran jeweils auf ca. 60-70 Umfang gekommen. Die Vorbereitungen müssen mit dem Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit geschrieben werden, sodass hier jedes Mal anspruchsvolle Dokumente entstanden sind. Für die Durchführung der Lehrproben gibt es einen Zeitraum von ca. 6 Wochen. Für diesen Zeitraum muss man als Lehrkraft in Ausbildung alle Unterrichtsthemen in den unterschiedlichen Klassen für das jeweilige Fach einrichten. Die Prüfer suchen sich dann eines der Themen aus – für dieses muss dann die Lehrprobe durchgeführt werden. Je nach Klassenstufe, Fach und individuellem Stunden umfasst die Lehrprobe dann eine einfache Unterrichtseinheit (45min) oder eine Doppelstunde (90min). Die Lehrprobe selbst wird dann zum jeweiligen Tag vor einem (zufälligen) Prüfer (mit Fachbezug) und dem FAL gehalten. Im Anschluss an die Lehrprobe hat man ca. 15 Minuten Zeit, um eine ausführliche Reflexion der Stunde vorzubereiten. Die Reflexion wird dann eigenständig ebenfalls mit einem Umfang von 15 Minuten vor den Prüfern referiert. Entscheidet die Kommission über Note und Bestehen und teilt diese auch direkt mit.
Mündliche Prüfung
Die Prüfung in den Bildungswissenschaften erfolgt normalerweise nach den Lehrproben. Bei mir lagen ca. 3 Wochen zwischen dieser Prüfung und den Lehrproben. Diese Prüfung wird vor insgesamt 3 Prüfern gehalten – einem (zufälligen) Prüfer (mit Fachbezug) sowie Hauptausbildungs- und Fachausbildungsleiter bzw. -leiterin. Die mündliche Prüfung läuft dabei wie folgt ab: Man bekommt zunächst eine kurze, schriftliche Beschreibung einer Situation aus dem Schulalltag ausgehändigt und hat dann ca. 5 Minuten Einlesezeit. Im Anschluss muss diese Situation innerhalb von 15 Minuten unter Berücksichtigung der bildungswissenschaftlichen Aspekte, der Fachdidaktik und der persönlichen Erfahrungen einordnet und bewertet werden. Weitere 15 Minuten der Prüfung sind für thematische Fragen der Prüfungskommission vorgesehen. Im Anschluss berät sich die Prüfungskommission und die Note wird bekannt gegeben.
Schulrechtsprüfung
Die Schulrechtsprüfung, findet bereits etwas eher am Ende des ersten Semesters statt. Am Schulrechtsunterricht nehmen alle Lehrkräfte in Ausbildung gleichermaßen teil. Interessant, aber nicht ganz nachvollziehbar ist jedoch, dass die Prüfung durch nur durch Seiteneinsteiger/-innen abzulegen ist, wenn diese eine Anerkennung von zwei Fächern haben. Die Prüfung findet in der Regel in Dreiergruppen statt und man bewertet konkrete Beispiele aus dem Schulalltag rechtlich.
Fazit: Ein langer Weg mit hohem Einsatz
Am Ende dieses Schuljahres konnte ich mich freuen, denn ich habe die spA sehr erfolgreich abschließen können. Das zurückliegende Jahr war jedoch unheimlich anstrengend und hat mich viel Energie gekostet. Während grundständig ausgebildete Referendare in der Regel 12 Stunden pro Woche unterrichten, unterrichten Seiteneinsteiger/-innen insgesamt 24 Stunden pro Woche. Das liegt nahe an den 26 Stunden einer fertig ausgebildeten Lehrkraft. Diese 24 Stunden fallen immer auf vier Wochentage, da ja ein Tag pro Woche für die Ausbildung reserviert ist.
Die Vorbereitung des Unterrichts in diesem Schuljahr hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, da ich viele Stunden zum ersten Mal gehalten haben. Absolviert man die spA (oder auch ein grundständiges Referendariat) am Gymnasium, muss man mindestens 6 Wochen in der Oberstufe unterrichten. In meinem Fall war es sogar ein komplettes Schulhalbjahr. Die Vorbereitung der Oberstufe hat sich als echter Zeitfresser erwissen, da hier ein fachlich deutlich höheres Niveau vorhanden ist und man auch methodisch anders arbeitet als in jüngeren Jahrgangsstufen.
Besonders in der Zeit der Lehrproben habe ich gemerkt, wie anspruchsvoll das alles ist. Man möchte die Lehrprobe optimal vorbereiten, aber parallel läuft ja auch der normale Schulalltag weiter. Die Arbeitswoche zwischen meinen beiden Lehrproben habe ich tatsächlich irgendetwas zwischen 80 und 100 Stunden gearbeitet. Aber auch die Wochen davor und danach waren mit 60-80 Wochenarbeitszeit sehr fordernd. Diese Arbeitszeit ist sicherlich immer eine Frage des persönlichen Anspruchs und Engagements, aber mir war es wichtig meine Prüfungen so gut wie möglich zu absolvieren ohne meinen Anspruch an den Unterricht im Alltag herunterzusetzen. Die anstehenden Sommerferien waren danach wirklich dringend nötig, um sich zu erholen und das hohe Arbeitspensum etwas auszugleichen.
Nun, da die spA abgeschlossen ist, geht es für mich ab Oktober mit der wissenschaftlichen Ausbildung an der Uni in meinem zweiten Unterrichtsfach weiter. Ich bin gespannt, welche Herausforderungen mich dort erwarten und freue mich auf dieses neue Kapitel.